-6-
Der Wind trug den süßen Duft des Frühlings mit sich, während er sanft über die Wasseroberfläche des Flusses strich. Elli stand am Ufer und starrte auf die träge fließenden Wellen. Ihre Augen waren leer, ihre Gedanken dunkel. Die Klinik lag nur wenige Minuten Fußweg entfernt, doch die Distanz fühlte sich an wie eine unüberwindbare Kluft.
Ihre Mutter hatte sie dort abgeliefert. Sie erinnerte sich an die ersten Tage dort: die kargen weißen Wände, das sterile Licht, das Gefühl, gefangen zu sein. Die Ärzte hatten ihr versprochen, dass sie nicht lange bleiben müsste und dass die Medikamente helfen würden.
Aber mit jeder Dosis wurde die Unruhe stärker, bis der Schlaf ganz ausblieb. Die Leere in ihr wurde immer größer, die Dunkelheit dichter. Sie erinnerte sich an die unendlich langen Minuten, die nicht vergingen, während sie auf dem Bett saß – unfähig zu lesen, unfähig, fernzusehen. Sie saß einfach da und starrte vor sich an die Wand. Wenn sie es schaffte, sitzenzubleiben. Doch meistens rannte sie den Flur auf und ab. Tag und Nacht. Ohne Schlaf. Bereits seit mehreren Wochen.
Es war eine altmodische Klinik. Es gab kaum Gespräche. Den Freunden und der Familie wurde vom Besuch abgeraten.
Jetzt stand sie allein am Ufer des Flusses. Ihre Gedanken wie im Nebel. „Eigentlich bin ich eine Kämpferin. Das hier bin ich nicht. Aber es geht nicht mehr weiter,“ sagte sie mit rauer Stimme in den Wind, wie eine Entschuldigung.
Es war ihr 25. Geburtstag. Sie war noch so jung, doch es ging nicht mehr weiter.
Ellis Beine zitterten, nicht nur vor Kälte, sondern auch vor der Schwere der Entscheidung, die vor ihr lag. Die Medikamente hatten sie in eine tiefe, schwarze Grube gestoßen, aus der sie keinen Ausweg mehr sah.
Sie erinnerte sich an das besorgte Gesicht des Arztes: „Wir haben jetzt fast alles probiert. Wir wissen nicht, warum die Medikamente nicht richtig wirken.“
Elli erinnerte sich an ihre bodenlose Verzweiflung während des Gesprächs. Doch durch den Nebel der Medikamente hatte sie sich kaum mit dem Arzt verständigen können.
Das Schlimmste war diese nagende Unruhe; sie wusste nicht, wie sie ein Leben auf diese Weise ertragen sollte.
Sie hatte es in dem Gespräch schließlich trotz ihrer verlangsamten Gedanken geschafft, etwas unbeholfen ihre größte Sorge auszusprechen: „Lässt sich das reparieren?“ hatte sie gefragt.
„Wir können Ihnen nicht versprechen, dass es sich bessert,“ hatte er gesagt.
Jetzt stand sie am Fluss. Ihre Gedanken waren ein einziges, wirres Durcheinander. Wenn sie nur Ruhe finden könnte! Sie konnte es vor innerer Unruhe kaum aushalten, hier am Ufer stehenzubleiben. Doch sie wollte auch nicht mehr weitergehen.
Sie blickte auf die Wellen des Flusses und schluchzte ein wenig, doch die Tränen blieben aus. Die Medikamente erzeugten eine Art Kokon in ihr, der sie innerlich lähmte. Sie konnte nicht mehr normal reagieren, nicht weinen. Sie hatte Bewegungsstörungen. Wenn sie versuchte zu schreiben, erkannte sie ihre eigene Schrift nicht wieder.
Aber die Gedankenschatten waren da und diese abgrundtiefe Traurigkeit und Verzweiflung; Und die unerträgliche Unruhe; Und die Schlaflosigkeit. Wochenlang.
Sie stand dort, wie gelähmt, und starrte auf den Fluss.
Ein plötzlicher Windstoß ließ sie frösteln. Sie zog mit ungelenken Bewegungen ihren Mantel enger um sich, als könnte er die Kälte in ihrem Inneren vertreiben. Sie wollte einfach ins Wasser gehen und den eisigen Fluss das letzte Kapitel ihres Lebens schreiben lassen.
Doch in der Dunkelheit blitzte ein Funken auf. Sie dachte an ihre Familie, an ihre Schwester, an ihre Freunde. „Ich kann nicht einfach aufgeben,“ murmelte sie leise zu sich selbst. Die Worte waren kaum mehr als ein Flüstern im Wind, aber sie fühlten sich an wie ein Versprechen.
Sie drehte sich langsam um, weg vom Fluss, und machte sich auf den Rückweg zur Klinik. Jeder Schritt fühlte sich schwer an, doch sie wusste, dass sie kämpfen musste. Für sich selbst, für die Menschen, die sie liebten, und für die Zukunft, die noch vor ihr lag.
Mit einem letzten Blick zurück auf den Fluss flüsterte sie: „Ich werde nicht aufgeben.“

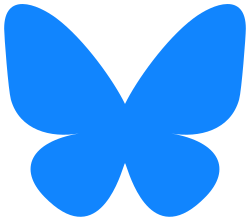



Schreibe einen Kommentar