Szene 45: Echos der Zeit – Hölderlin und die Prophezeiung
Stiftsbibliothek im Evangelischen Stift Tübingen, 1802
In der gedämpften Atmosphäre der Stiftsbibliothek sitzt Friedrich Hölderlin an einem großen Fenster, durch das der blasse Winterschein ins Zimmer fällt. Um ihn herum ragen hohe Bücherregale auf, gefüllt mit den Werken vergangener Zeiten, die das Wissen und die Weisheit der Jahrhunderte bewahren. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein schwerer, alter Foliant, den er sorgsam geöffnet hat. Es handelt sich um eine kunstvoll gestaltete Handschrift einer Bibelübersetzung aus Luthers Zeit. Am Rand des Textes stehen handschriftliche Notizen von Luther, und in dem Folianten sind zahlreiche lose Seiten mit weiteren Schriften des Reformators eingefügt.
Hölderlin ist besonders von einem dieser Blätter fasziniert. Seine Augen folgen den kunstvoll geschriebenen Zeilen, bis sie bei den Worten der Prophezeiung verharren. Er liest sie wieder und wieder, tief beeindruckt von der Bedeutung, die in ihnen liegt. Gedankenverloren murmelt er das Wort „glossai“, und in diesem Moment spürt er eine geheimnisvolle Verbindung zwischen dieser uralten Schrift und seiner eigenen Arbeit.
Neben dem Folianten liegt ein unvollendetes Manuskript – es ist sein Gedicht „Patmos“, an dem er in diesen Tagen arbeitet. Mit der Feder in der Hand beginnt er, die ersten vier Zeilen niederzuschreiben:
„Nahe ist
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.“
Er hält inne und lässt seine Worte auf sich wirken. Die Vision des „Feuertragenden“, die er in seinem Gedicht beschreibt, kehrt vor sein inneres Auge zurück – ein Wesen von großer Kraft und strahlendem Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Plötzlich wird ihm klar, dass der „Feuertragende“ und das „rastlose Wesen“ aus der Prophezeiung in Wahrheit dasselbe sind. Dieses Wesen, das zwischen Welten wandert, Licht trägt und die Dunkelheit besiegt, ist der Schlüssel.
Tief in Gedanken versunken, legt Hölderlin die Feder nieder und lehnt sich zurück. Die Worte der Prophezeiung und seine eigenen Verse verschmelzen in seinem Geist, und er spürt eine tiefe Verbindung zu den uralten Zeilen, die vor ihm liegen. In diesem Augenblick begreift er, dass er eine Botschaft übermitteln soll – eine, die über die Zeiten hinaus Bestand haben wird.
Er blickt erneut auf die kunstvoll geschriebenen Worte der Prophezeiung. Es ist, als sprächen die Worte direkt zu ihm, flüsternd durch die Jahrhunderte. Sein Herz schlägt schneller, als er die Tiefe ihrer Bedeutung zu begreifen beginnt. Es fühlt sich an, als hätte er einen Schlüssel zu einem verborgenen Wissen gefunden, das nur darauf gewartet hat, von ihm entdeckt zu werden.
Mit zitternden Händen schreibt er an den Rand des Pergaments, direkt neben die Worte der Prophezeiung: „Diese Worte, so alt und doch so ewig jung, sprechen zu mir über die Grenzen der Zeit hinweg. Kleobis, Martin Luther, Bruder Iskender und Bruder Lukas – sie alle haben ihre Gedanken hier hinterlassen, ihre Fragen und ihre Hoffnungen. Nun füge ich meine Stimme der ihren hinzu, in der tiefen Überzeugung, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind. Diese Prophezeiung ist ein lebendiges Vermächtnis, ein Funke der Inspiration, der nie erlischt.“
Er legt die Feder beiseite und lehnt sich zurück, die Worte in seinem Geist nachklingend. In dieser stillen Stunde fühlt er sich zutiefst verbunden mit all jenen, die vor ihm die Prophezeiung niedergeschrieben haben. Es ist, als hätte er durch die Jahrhunderte hindurch ihre Hände auf seiner Schulter gespürt, eine leise Ermunterung, den Stab weiterzutragen und die Botschaft an die kommenden Generationen zu übermitteln.
Hölderlin weiß, dass er Teil einer Kette ist – eines unaufhörlichen Flusses von Wissen und Weisheit, der niemals endet. Und in diesem Moment schwört er, die Worte der Prophezeiung zu ehren und ihre Botschaft durch seine Poesie weiterzutragen.
Vorsichtig blättert er weiter und entdeckt einige weitere lose Seiten. Es sind mit Tinte beschriebene Manuskripte – Kommentare und Analysen zum Hohelied. Die Handschrift erkennt er sofort: Es sind Luthers eigene Texte. Neugierig nimmt er die Papiere zur Hand, um sie eingehender zu betrachten.
„Resonanz“, murmelt er leise, als er Luthers Anmerkungen zu den ersten Versen des Hohelieds der Liebe liest. Luther spricht von der zentralen Rolle der Liebe in der Kommunikation und Verbindung zwischen den Menschen. Er beschreibt die Resonanz als Botschaft der Liebe und als die Kraft, die selbst die Grenzen von Zeit und Raum überwinden kann.
Hölderlin fühlt sich von diesen Worten tief berührt. Er denkt an das „rastlose Wesen“ aus der Prophezeiung, an den „Feuertragenden“, den er in „Patmos“ beschreibt. Könnte es sein, dass alle diese Bilder und Gedanken auf das Gleiche hinauslaufen? Auf die Liebe, die größte Kraft des Universums – das, was alles zusammenhält und alles überdauert?
Mit zitternden Händen blättert Hölderlin weiter in Luthers Analyse. Die Ausführungen zu den mittleren Versen des Hohelieds, zur Umgrenzung der Liebe und zur Darstellung ihrer vielfältigen Facetten, erscheinen ihm wie eine Erweiterung dessen, was die Prophezeiung andeutet. Jede Facette der Liebe birgt eine tiefe Resonanz in sich, die alles verbindet.
Dann stößt er auf Luthers Kommentar zu den letzten Versen des Hohelieds. Dort beschreibt Luther die Entwicklung der Liebes- und Kommunikationsfähigkeit der Menschheit – eine Menschheit, die zwar unvollkommen ist, aber dennoch in der Lage, Liebe zu empfinden, zu geben und zu empfangen. Die Liebe, so Luther, sei die größte Gabe, die dem Menschen zuteilwerden kann, und Hölderlin fühlt, wie sehr er diesen Gedanken teilt.
„Das Rettende“, flüstert er, „ist vielleicht die Liebe selbst.“
Die Worte hallen in der Stille der Bibliothek nach, und Hölderlin spürt, wie eine neue Erkenntnis in ihm aufsteigt – eine Einsicht, die alles verändert. Er blickt erneut auf die Prophezeiung, auf seine eigenen Verse, auf Luthers Analyse des Hohelieds. Plötzlich erscheint ihm alles in einem neuen Licht. Alles ist miteinander verwoben, alles führt zurück zur Liebe – in all ihren Formen und Ausprägungen, und besonders in ihrer Verbindung zur Resonanz und Kommunikation.
Mit neuem Elan greift Hölderlin nach seiner Feder, getrieben von den Gedanken, die Luther und die uralten Worte in ihm geweckt haben. Sein Herz pocht im Einklang mit der neuen Erkenntnis, und die Worte fließen ihm leichter aus der Feder, als wäre eine innere Barriere gefallen.
„In der Symbiose von Liebe und Kommunikation“, schreibt er, „entdecken wir ein ewiges Echo, eine Resonanz, die durch die Zeiten hallt und uns in einen heiligen Zirkel einbindet. Liebe ist nicht nur die Grundlage unserer Kommunikation mit der Welt und den Menschen um uns herum, sondern auch die Substanz, aus der unsere tiefsten Verbindungen gewebt sind. In der Kommunikation finden wir den Ausdruck der Liebe, und in der Liebe entdecken wir die tiefste Form der Kommunikation.“
Die Worte sprudeln aus ihm heraus, als ob sie von einer höheren Macht geleitet werden. „Liebe und Kommunikation sind untrennbar miteinander verbunden, sie nähren einander und wachsen in einem ewigen Tanz der Resonanz. In der vollkommenen Form dieser Resonanz liegt vielleicht ein Vorgeschmack auf das Vollkommene, das uns in der Zukunft erwartet – ein Zustand der Harmonie und des tiefen Verstehens, wie Paulus es prophezeit hat.“
Hölderlin spürt, wie die Worte mühelos fließen, und schreibt weiter. „In diesem heiligen Zirkel aus Liebe und Kommunikation finden wir den Schlüssel zur Überwindung unserer Unvollkommenheit, zur Heilung der Brüche, die die Welt entzweien. Es ist die Liebe, die uns lehrt, einander wirklich zu verstehen, und es ist die Kommunikation, die uns ermöglicht, diese Liebe auszudrücken und zu teilen.“
Er hält inne, atmet tief durch und lässt die Worte in sich nachhallen. „In der Verbindung von Liebe und Kommunikation“, fügt er hinzu, „liegt die Möglichkeit zur Transformation, zur Überwindung der Grenzen, die uns trennen. Durch die Resonanz dieser heiligen Verbindung kommen wir einander näher, bauen eine Brücke zwischen den Seelen und berühren einander in unserer tiefsten Essenz.“
Mit einem letzten Strich setzt Hölderlin den Punkt, lehnt sich zurück und betrachtet, was er geschrieben hat. Er spürt, dass er etwas berührt hat, das weit über die Worte auf dem Papier hinausgeht. In der Stille der Bibliothek weiß er, dass er einen Schlüssel gefunden hat – einen Weg, die Botschaft des Hohelieds der Liebe und der Prophezeiung in die Welt zu tragen.
„Möge diese Botschaft“, flüstert er, „wie eine Resonanz durch die Zeiten hallen und die Herzen der Menschen öffnen für die Liebe und die Kommunikation, die uns alle verbindet.“
Doch Hölderlin ist trotz allem bewusst, dass die Liebe, so groß und mächtig sie auch ist, immer auch von der Erfahrung der Trennung und des Schmerzes geprägt bleibt. Der Mensch, immer getrennt von der Welt, strebt danach, durch die Liebe Einheit zu finden, doch diese Einheit bleibt fragil und unvollständig. Die Liebe mag die Kluft überbrücken, aber sie kann die grundlegende Trennung nicht vollständig aufheben.
In der Stille der Bibliothek wird ihm bewusst, dass die menschliche, unvollkommene Version der Liebe nicht nur das Verbindende ist, sondern auch das, was uns auf unsere eigenen Grenzen hinweist. Die Sehnsucht nach dem Gegenüber, nach Verbindung, entsteht nur aus dem Bewusstsein der eigenen Einsamkeit und Begrenztheit. Es ist der tragische Widerspruch, der die menschliche Liebe gleichzeitig zur größten Kraft und zur größten Herausforderung macht: Sie bringt uns einander näher, doch bleibt immer das Wissen, dass diese Nähe nie vollkommen ist.
Es ist diese Erkenntnis, die Hölderlins Poesie antreibt – das unaufhörliche Streben nach einer vollkommenen, idealen Liebe, die der Mensch jedoch immer nur fragmentarisch erfahren kann.
Hölderlin spürt das Gewicht dieser Tragik, aber zugleich erkennt er darin auch eine Schönheit. Die Unvollkommenheit, die Begrenztheit des Menschen ist es, die das Streben nach Liebe überhaupt erst möglich macht. Es ist der Schmerz, der den Wert der Liebe erst sichtbar macht.
Er lächelt leise, als ihm klar wird, dass es vielleicht genau diese paradoxe Spannung ist, die der menschlichen Liebe ihre größte Kraft verleiht – eine Kraft, die trotz aller Begrenzungen die Menschen verbindet und durch die Zeiten hindurch hallt.
Doch während Hölderlin seine Feder beiseitelegt und in die Stille der Bibliothek lauscht, wird ihm noch eine weitere Wahrheit bewusst. Die Liebe, die er so leidenschaftlich beschreibt, ist aus all diesen Gründen nicht nur eine Brücke zum Gegenüber – sie beginnt auch im Selbst. Er erinnert sich an die Worte des Hohelieds, die von der unvollständigen Erkenntnis sprechen, vom Spiegel, der nur ein dunkles Bild zeigt. Jetzt versteht er, dass diese unvollkommene Erkenntnis nicht nur auf das Gegenüber, sondern auch auf das eigene Ich zutrifft.
„Die Liebe zum Gegenüber“, murmelt er leise, „kann nur dann wahrhaftig sein, wenn sie in einer Liebe zu sich selbst wurzelt.“ Denn nur ein Ich, das seine Grenzen erkennt, das sich selbst abgrenzt und definiert, kann in Resonanz mit dem Gegenüber treten. Die Abgrenzung ist nicht Trennung, sondern ein notwendiger Schritt, um zur echten Nähe zu gelangen. Resonanz bedeutet schließlich, dass zwei Entitäten miteinander schwingen, dass ein Widerhall zwischen ihnen entsteht – nur wenn das Ich in gewisser Weise sich selbst umgrenzt und festigt, kann es diesen Widerhall mit dem Gegenüber wahrhaftig erleben.
Hölderlin denkt darüber nach, wie die menschliche Liebe immer auch von der Spannung zwischen Selbst und Gegenüber lebt. Diese Abgrenzung des Ichs – der Spiegel, der ein unvollkommenes Bild liefert – schafft den Raum, in dem Begegnung und Resonanz möglich werden. Erst wenn das Ich sich selbst zu lieben vermag, wenn es seine eigene Begrenztheit akzeptiert, kann es sich öffnen und das Gegenüber wirklich verstehen.
Hölderlin spürt, dass in dieser Erkenntnis eine tiefere Wahrheit liegt: „Die Liebe zu uns selbst“, flüstert er, „ist der Spiegel, in dem wir die Liebe zum Gegenüber erkennen.“ Und es ist die Liebe, die uns befähigt, über uns selbst hinauszugehen und die Trennung zu überwinden.
Richtig ist dabei auch die Aussage aus dem Hohelied, dass dieser Spiegel für den Menschen ein dunkles Bild liefert. Denn wir können uns selbst und unser Gegenüber niemals vollkommen und unvermittelt erfassen. Ursache hierfür ist wohl nicht zuletzt der Umstand, dass wir und unser Gegenüber und die Welt um uns herum uns ständig entwickeln und verändern.
Doch in der Resonanz, in der sowohl Liebe als auch Dichtung schwingen, findet Hölderlin den Schlüssel zum überhaupt menschenmöglichen Weg zur Überwindung der Grenzen – Grenzen, die uns trennen, aber zugleich das Streben nach Verbindung erst möglich machen.
Leise murmelt er vor sich hin: „Die Liebe, die wir erfahren, mag bruchstückhaft sein, doch sie birgt das Versprechen von etwas Größerem. In der Tiefe der unvollkommenen Liebe liegt bereits der Funke des Vollkommenen.“
Hölderlin spürt, wie die Erkenntnis in ihm nachhallt. Die Liebe und die Poesie sind der ewige Versuch, das Fragmentarische zu überwinden, die Kluft zu schließen – ein Streben, das trotz allem nie aufhört. Er lächelt, wissend, dass es in diesem Streben, in dieser Bewegung zwischen Nähe und Trennung, in der Resonanz der Liebe selbst, eine Wahrheit gibt, die die Zeiten überdauert.
Er blickt auf seine geschriebenen Worte und weiß, dass sie eine Botschaft tragen – eine, die über das Vergängliche hinaus in die Herzen der Menschen fließen wird, als Resonanz der Liebe, die alles durchdringt.

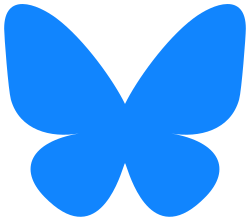



Schreibe einen Kommentar